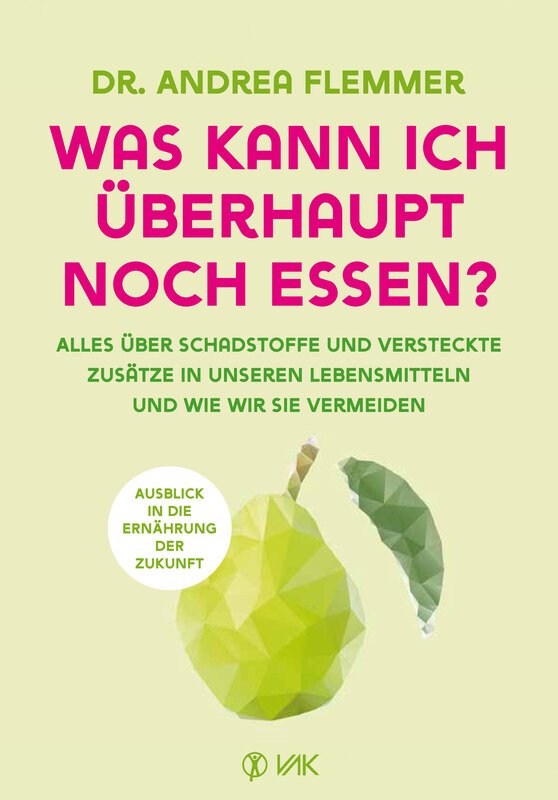Ausschnitt, Teil 2, aus Dr. Andrea Flemmer: Was kann ich überhaupt noch essen?, Kirchzarten 2024, ISBN 978-3-86731-277-6, S. 64 ff.
Die Stiftung Warentest hat bei Phosphaten Bedenken. Sie konservieren, wirken als Antioxidantien, Säuerungsmittel, Emulgator, Rieselstoffe etc. Man findet sie als E 338 – 341 sowie E 450 – E 452 in fast allem was Kindern schmeckt: Back- und Süßwaren, Wurst, Schmelzkäse, Milchspeisen, Limos und Cola-Getränke. Eigentlich sollte der Zusatz von Phosphat möglichst gering sein, um das Phosphat-Kalzium-Verhältnis und damit die Knochenstabilität nicht zu gefährden. Eine amerikanische Studie stellte fest: Sportliche Mädchen, die viel Cola tranken, erlitten 5mal häufiger Knochenbrüche als Mädchen, die lieber Mineralwasser trinken. Auch bei anderen Teenagern, die die sprudelnden Softdrinks bevorzugen, war das Risiko für einen Knochenbruch erhöht.
Auch das Zappelphilipp-Syndrom soll auf die hohe Phosphatzufuhr zumindest zum Teil zurückgehen. Beweisen konnte man das zwar nicht. Jedoch führten Diäten ganz ohne Zusatzstoffe – also Selbstgekochtes – bei den betroffenen Kindern häufig zur Besserung.
Gerne werden Würsten Phosphate zugesetzt. Dort wirken sie als Stabilisatoren, die das Wurstbrät geschmeidiger machen.
Gefährlich ist Phosphat vor allem für Menschen deren Nierenfunktion beeinträchtigt ist. Vor allem Kleinkinder nehmen bis zu zwölfmal höhere Sulfitmengen (E 220 – E 228) zu sich, als der ADI-Wert vorgibt.
Viele Zusatzstoffe werden gentechnisch hergestellt. Hier weiß man noch nicht sicher, ob dies eine gesundheitsschädliche Wirkung haben kann oder wird.
Legal versteckte Substanzen
Seit Januar 2003 regelt ein EU-weites Gesetz, was alles auf dem Etikett eines verpackten Lebensmittels stehen muss – und was nicht. Die drei wichtigsten Regeln hierfür lauten:
Wenn die zugesetzte Substanz nur für den Herstellungsprozess von Nutzen ist, also eine so genannte „technologische Wirkung“ hat, braucht sie im Endprodukt nicht mehr erwähnt zu werden. Beispiele sind Enzyme (s. Anhang, Lexikon), die das Produkt luftig und locker aufgehen lassen. Bei folgenden Lebensmitteln braucht man gar keine Zutaten anzugeben:
* einzeln verkaufte Zuckerfiguren
* Lebensmittel in sehr kleinen Verpackungen, deren größte Einzelfläche weniger als 10 cm² benötigt.
* bei lose verkauften Lebensmitteln wie z. B. Brötchen oder Aufschnitt genügen
Gruppenbezeichnungen wie beispielsweise „Farbstoffe“ oder „Konservierungsstoffe“.
Ausnahme: Werbung auf Infoblättern oder Plakaten muss die Details enthalten.
Wie geht man am besten mit den Zusatzstoffen um?
Generell gilt: So wenig Zusatzstoffe, und so harmlose wie möglich, sind die beste Voraussetzung für eine allergenarme Ernährung! Dies gelingt am leichtesten, wenn man wenig Fertiggerichte (z.B. Fertigsuppen und –kuchen, Dosenmahlzeiten), also wenig verarbeitete Lebensmittel kauft. Fertigprodukte sind oft mit zahlreichen Zusatzstoffen versehen, leicht zu erkennen an der langen Liste im Zutatenverzeichnis.
Aromen oder Geschmacksverstärker beeinflussen unser natürliches Geschmacks-empfinden. Am besten so wenig wie möglich „genießen“.
Vorsicht: Zusatzstoffe müssen auf der Verpackung angegeben sein, aaaaber: wer kann mit diesen Bezeichnungen schon etwas anfangen? Im Grunde bräuchte man dazu mindestens ein Chemie-, Lebensmittelchemie, Lebensmitteltechnologie- oder Ökotrophologie-Studium – am besten mehrere! Das heißt: um sich selbst zu helfen besser ein Produkt wählen mit möglichst wenig Zusatzstoffen!