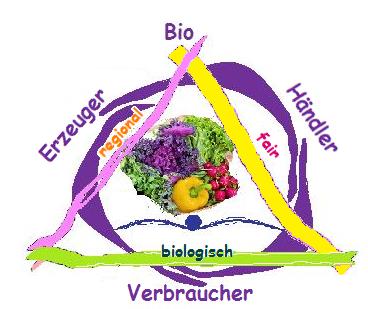Essen, was uns selbst und der Erde gut tut – die Ernährungsexpertin Maike Ehrlichmann zeigt, warum das jetzt ansteht und wie es gehen kann (Teil 1 in Info-Brief 59).
Stellen wir uns einmal vor, was in den Köpfen und Herzen passiert, wenn sie in der Süddeutschen Zeitung lesen: „43 Gramm Fleisch am Tag sind genug“. Oder in der Schlagzeile des Spiegel „Iss nur 43 Gramm Fleisch pro Tag, rette die Welt“. „Wer gesünder leben und dabei die Umwelt schützen will, sollte weniger Rindfleisch essen“, titelt die Zeit.
Dabei will ich jetzt nicht einmal die Frage stellen, ob nicht deutlich zu unterscheiden wäre zwischen einem Rind aus industrieller Landwirtschaft, einem Bio-Rind und einem aus biodynamischer Landwirtschaft. Daran hat sich beispielsweise Dr. Anita Idel abgearbeitet und das in ihrem Buch Kühe sind keine Klimakiller dargelegt. Mir geht es darum, ob solche Nachrichten zum Handeln motivieren. Sicherlich bestärken diese krassen Zahlen alle, die sich ohnehin schon bemühen. Aber es wird auch viel Frustration geben: „Erst die Ökosteuer und jetzt nimmt man mir auch noch mein Steak weg!“
In der Bild am Sonntag vom 17.02.2019 wurde es ein bisschen vorsichtiger erklärt und ein positives Bild aus der guten alten Zeit bemüht: den Sonntagsbraten. Zu einer Portion davon summiert sich nämlich die tägliche Fleischmenge im Laufe einer Woche auf. So könnte man es also auch machen. Damals, in den 1950ern und 1960ern, habe man noch nachhaltiger gegessen, so der Ernährungswissenschaftler und Lebensmittel-Experte Prof. Dr. Guido Ritter im Gespräch mit dem Blatt. Und wir haben alle noch viel mehr für unser Essen arbeiten müssen, es war weitaus teurer. „Oma hat es gut gemacht, das können wir auch!“ Das ist doch schon einmal eine positivere Herangehensweise.
Motivation ist wichtiger als Grammangaben
Um das Ernährungsverhalten zu verändern, ist Motivation wichtiger, als es exakte Grammangaben sind. Am besten etwas, das von innen heraus kommt. Denn die eigenen Emotionen wirken stärker als jede logische Überlegung! Tatsächlich zeigt die Verhaltensforschung zu Klimawandel (ja, das ist inzwischen eine eigene Disziplin!), dass alle Erkenntnisse über die Klimakrise die Menschen noch kaum zu einem CO2-bewussteren Handeln bewegt haben. Selbst bei einem Anstieg des Wissens und der Überzeugung, dass die Krise da ist, wächst das klimarelevante Handeln nicht mit. Bewusstsein reicht also nicht?
Ich kann dieses Phänomen nur aus der Ernährungssicht bestätigen. Wird mir jemand mit stark erhöhten Cholesterinwerten vom Arzt geschickt, so weiß er sicher über sein Risiko für sein Herz Bescheid. Der Arzt hat es ihm erklärt, ich tue das und bestimmt hat er auch schon gegoogelt. Aber anders zu essen ist trotzdem schwer. Viel einfacher und schneller fällt eine Ernährungsumstellung beispielsweise einem Patienten, der einen Herzinfarkt erlitten hat.
Das Wünschenswerte leichter machen
Viele Konzepte sind schon ganz offensichtlich. Ich bin da keine Expertin, aber mir fällt sofort das Stichwort „wahre Preise für Lebensmittel“ ein (info3 berichtete im Dezember). Unter dem Titel „Was kosten uns die Lebensmittel wirklich“ hatte etwa die Schweisfurth Stiftung im vergangenen Jahr eine Studie dazu veröffentlicht. Sie haben Stickstoff, Klimagase, Energieerzeugung auf die Lebensmittelpreise aufgeschlagen. Eines der Ergebnisse: Konventionelle Milcherzeugnisse müssten im Laden etwa 30 Prozent teurer sein, biologische nur etwa zehn Prozent. Konventionelle Produkte kosten also in Wahrheit etwa so viel wie die Biovarianten.
Eine Umsetzung davon wäre nur ein Gedanke zum politischen Eingreifen. Viele NGOs, wie etwa Greenpeace, Slowfood oder das Bündnis Wir haben es satt haben überzeugende Forderungen gestellt, statt finanzieller Förderung klimaschädlicher Produktion eine nachhaltige Landwirtschaft zu unterstützen. (Siehe dazu auch unseren Beitrag im Leitartikel. Die Red.)
Solche Maßnahmen haben übrigens auch die Wissenschaftler der Lancet-Studie eingefordert. Vielleicht wäre es eine schöne Aufgabe für die Medien gewesen, diese Botschaft weiterzutragen und nicht nur mit aufmerksamkeitsheischenden Titeln zu provozieren: Wie wir mit Messer und Gabel die Welt retten sollen. Durch intelligente politische Vorgaben können wir eine Welt formen, in der das auch die breite Masse will.
Quelle: Maike Ehrlichmann: Die Planetendiät in der Zeitschrift info3 März 2019 (Ausschnitte); siehe auch das Buch der Autorin: Einfach ehrlich essen, 2017 ISBN 978-3-7776-2662-8