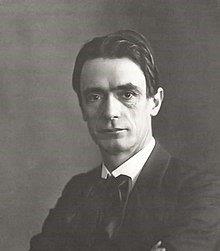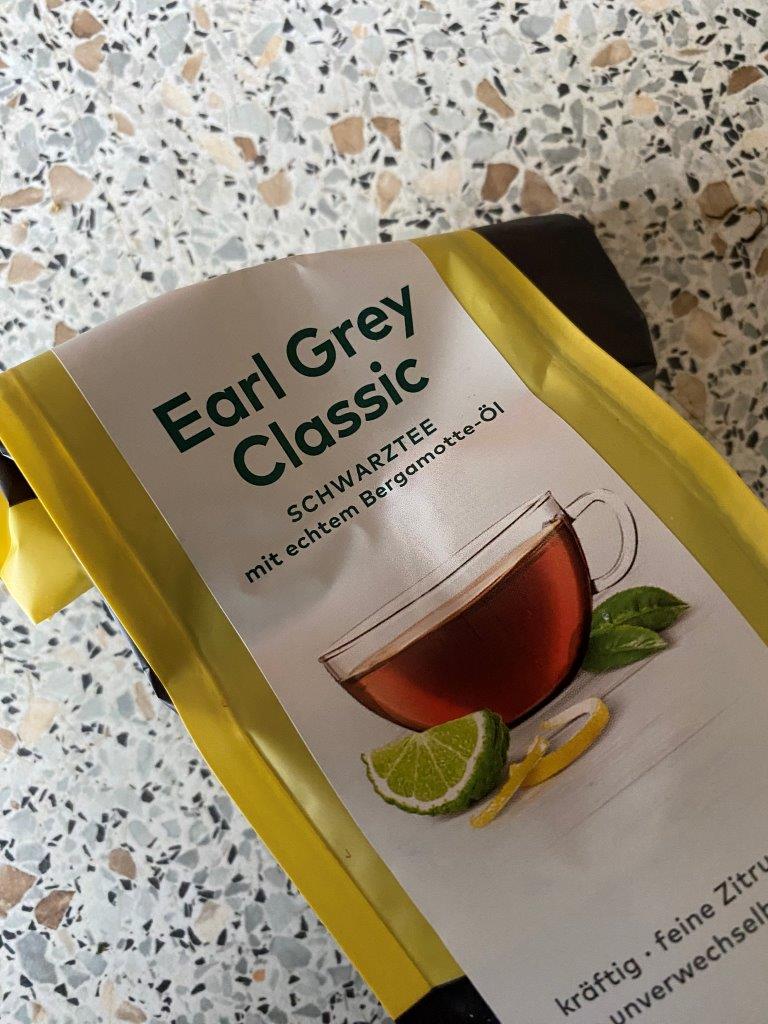Bericht von Wolfgang Ritter
Cornflakes können aus Dinkel, Mais, Braunhirse, Buchweizen oder gemischten Getreidesorten bestehen. Sie dürfen Zucker, Salz und Ballaststoffe enthalten, wenn das deklariert ist. Pestizidrückstände, Acrylamid, Mineralölbestandteile, Schwermetalle und Schimmelpilzgifte sollten sie nicht enthalten. Daraufhin hat ÖKO-TEST die 48 Proben untersuchen lassen. Die gute Botschaft: 14 Bio-Produkte sind „sehr gut“, je vier „gut“ und „befriedigend“. Die schlechte Botschaft: vier sind „mangelhaft“, eines „ungenügend“ (Acrylamid „erhöht“ und „weitere Mängel“ oder Acrylamid „stark erhöht“ und teilweise zusätzlich „weitere Mängel“). Kaufen Sie ein einwandfreies Produkt? Prüfen Sie hier:
„Sehr gut“ (Preise je 300 g)
Alnatura Cornflakes, glutenfrei, 1,75 €; Alnatura Mini Dinkelflakes, ungesüßt, Bioland, 3,93 €; Bauck Mühle Corn Flakes, glutenfrei, Demeter, 2,76 €; Campo Verde Dinkel Flakes, Demeter, 3,65 €; Davert Cornflakes, glutenfrei, 3,35 €; Davert Dinkelflakes, Bioland, 3,59 €; Dm Bio Dinkelflakes, Naturland, 1,84 €; Ener Bio Cornflakes, ohne Zuckerzusatz, 1,79 €; Ener Bio Cornflakes, ohne Zuckerzusatz, Bioland, 2,54 €; Hensel Bio Dinkelvollkorn Flakes, 4,92 €; K Bio Dinkelflakes/Kaufland, 1,84 €; Rewe Bio Dinkel Flakes, Naturland, 2,39 €; Spielberger Mühle Cornflakes, glutenfrei, Demeter, 3,59 €; Verival Bio Cornflakes, glutenfrei, 3,59 €
„Gut“ (Preise je 300 g)
Bio Primo Dinkelflakes/Müller Drogeriemarkt, ungesüßt, 2,25 €; Edeka Bio Cornflakes, ungesüßt, 1,99 €; Spielberger Mühle Dinkelflakes, ungesüßt, Demeter, 4,19 €; Wurzener Bio Corn Flakes, ohne Zuckerzusatz, 2,07 €
„Befriedigend“ (Preise je 300 g)
Barnhouse Flakes Dinkel, 4,49 €; Bio Zentrale Cornflakes, ungesüßt, 3,59 €; Dm Bio Cornflakes, ungesüßt, glutenfrei, 1,45 €; Werz Buchweizen Flakes Vollkorn, ungesüßt, glutenfrei, 7,55 €
„Ausreichend“ (Preis/ 300 g)
Barnhouse Cornflakes Original, 3,03 €
„Mangelhaft“ (Preise je 300 g)
Alnavit Bio Cornflakes, glutenfrei, 2,39 €; Dennree Cornflakes, 1,59 €; Koro Bio Cornflakes, ohne Zuckerzusatz, 2,03 €; Werz Braunhirse Flakes, glutenfrei, 5,99 €
„Ungenügend“ (Preis/ pro 300 g)
Bio Primo Cornflakes/Müller Drogeriemarkt, ungesüßt, 1,45 €
Quelle: ÖKO-TEST Magazin 5.2024